Topthema
April 2025
Ecstasy gilt als Partydroge. Die bunten Pillen stimmen euphorisch und erzeugen ein Gefühl von Nähe zu anderen Menschen. Doch was passiert eigentlich im Gehirn? Ist der Ecstasy-Wirkstoff MDMA neurotoxisch, also schädlich für Nervenzellen?
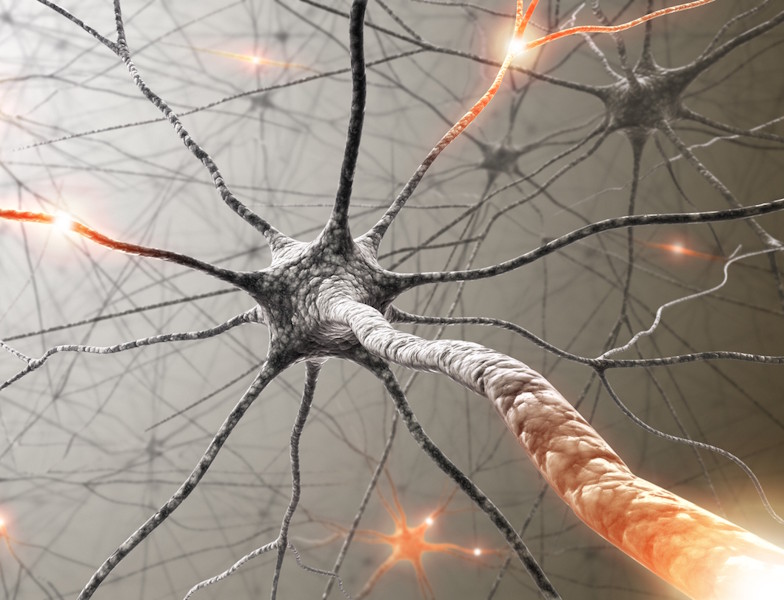
Bild: ktsimage / istockphoto.com
Es geht um schöne Gefühle. Der Ecstasy-Wirkstoff MDMA kann ein Wohlbefinden auslösen, das sich nach Glück und Liebe anfühlt. Denn Gefühle sind letztlich das Resultat von Botenstoffen in unserem Gehirn. Und die typische Wirkung von Ecstasy lässt sich überwiegend auf eine vermehrte Ausschüttung des Botenstoffs Serotonin zurückführen. Was sagt die Wissenschaft zu den Auswirkungen von MDMA auf das Nervensystem?
Die Erforschung von MDMA beginnt Anfang des letzten Jahrhunderts. Der Pharmahersteller Merck hatte MDMA 1912 in einem Patent erwähnt. Allerdings waren die psychoaktiven Effekte damals noch nicht bekannt oder zumindest nicht Gegenstand der Forschung. Das änderte sich erst, als in den 1960er Jahren der US-amerikanische Chemiker Alexander Shulgin mit MDMA experimentierte. Ob Shulgin selbst die Droge genommen hat, ist nicht gänzlich aufgeklärt. Klar ist aber, dass die Droge in der Folge Eingang fand in die experimentierfreudige Psychotherapie-Szene Kaliforniens. Therapeutinnen und Therapeuten versprachen sich einen leichteren Zugang zu den Gefühlen und inneren Konflikten ihrer Patientinnen und Patienten.
Irgendwann hat auch das Partyvolk die Droge für sich entdeckt. Inzwischen findet sich Ecstasy in jeder Statistik zum Drogenkonsum. Befragungen in 26 europäischen Ländern zeigen, dass 2,3 Millionen junge Menschen im Alter zwischen 15 und 34 Jahren im letzten Jahr Ecstasy konsumiert haben. Das sind 2 Prozent in dieser Altersgruppe.
Laut repräsentativer Zahlen aus Deutschland haben 10 Prozent der 25- bis 29-Jährigen schon mal Ecstasy konsumiert. Die meisten jungen Erwachsenen belassen es beim Probierkonsum. Aber etwa 5 Prozent der Konsumerfahrenen nehmen Ecstasy monatlich und rund 1 Prozent sogar wöchentlich.
Seit den 1980er Jahren wurden zahlreiche Studien zu der Frage durchgeführt, ob und wie neurotoxisch, also wie schädlich Ecstasy für Nervenzellen ist. Dabei konzentrierte sich ein Teil der Studien auf so genannte bildgebende Verfahren, die einen Blick ins Innere unseres Gehirns erlauben. Ein Forschungsteam der Universität Basel hat in einer Meta-Analyse 16 Einzelstudien zusammengefasst.
Studienleiter Stefan Borgwardt und sein Team kommen zu folgendem Ergebnis: Bei Ecstasykonsumierenden fand sich in 8 von 13 der untersuchten Hirnregionen eine geringere Dichte an Serotoninrezeptoren im Vergleich zu Kontrollpersonen. Zudem konnte die Abnahme eines bestimmten Proteins, das für den Transport des Neurotransmitters Serotonin verantwortlich ist, nachgewiesen werden. Die Folge ist ein niedrigerer Serotoninspiegel. Die Abnahme des Serotoninspiegels wird meist als Hinweis auf Nervenschäden gewertet. Denkbar sei aber auch, dass die Serotoninproduktion aufgrund der häufigen MDMA-Wirkung heruntergeregelt wurde.
Entgegen den Erwartungen fanden die Forschenden keinen Zusammenhang zwischen der Häufigkeit des Ecstasykonsums und dem Ausmaß der Schädigung. Borgwardt und sein Team vermuten, dass Nervenschäden nicht generell durch häufigen Konsum, sondern eher durch hohe Einzeldosen hervorgerufen werden. Die Studien liefern allerdings nicht genügend Daten über die Höhe der Ecstasydosis bei einzelnen Konsumepisoden, um diese Vermutung testen zu können.
Erkenntnisse über die zugrundeliegenden Mechanismen der Neurotoxizität beruhen überwiegend auf Tierversuchen. Insofern können diese nur Hinweise liefern. Sie zeigen aber auf, dass MDMA auf unterschiedliche Weise die Nerven schädigen kann. Eine wichtige Rolle spielt ein Prozess, der als oxidativer Stress bezeichnet wird.
MDMA produziert besonders reaktionsfreudige Moleküle, denen ein Elektron fehlt. Diese so genannten freien Radikale erzeugen Stress, weil sie den Zellen Elektronen entreißen. Normalerweise repariert unser Körper solche Defekte. Nehmen freie Radikale überhand, wie beim Konsum von MDMA, reichen die körpereigenen Mechanismen aber nicht mehr aus, um Nervenzellschäden zu reparieren.
Ein weiterer Mechanismus, der Nerven schädigt, hängt mit der Aktivierung von Gliazellen durch MDMA zusammen. Gliazellen, insbesondere Mikrogliazellen und Astrozyten, stellen eine Art Abwehrfront des Gehirns dar und haben eigentlich eine nervenschützende Funktion. Durch MDMA schlagen Gliazellen aber Alarm. Dies hat Entzündungsreaktionen zur Folge, die zu Nervenschäden führen.
Beobachtet wurde auch, dass die Neurotoxizität bei erhöhter Körpertemperatur steigt. Das kann in einer heißen Umgebung wie engen, schlecht belüfteten Clubs oder auch bei körperlicher Anstrengung wie beim Tanzen der Fall sein. Besonders bei hohen Dosen MDMA kann die Körpertemperatur gefährlich hoch ansteigen. Dann steigt aber nicht nur das Risiko für Nervenschäden. Hohe Dosen Ecstasy können lebensbedrohlich sein. Manche Menschen sind auch aufgrund ihrer Gene stärker gefährdet, weil bestimmte Enzyme nicht richtig arbeiten, die für den Abbau der Droge zuständig sind.
Die strukturellen Veränderungen im Gehirn können auch einhergehen mit Einschränkungen der geistigen Leistungsfähigkeit. Studien legen nahe, dass besonders das verbale Gedächtnis betroffen ist. So schneiden Ecstasykonsumierende in Tests zur Worterinnerung oft schlechter ab als nicht-konsumierende Personen. Besonders mit zunehmender Schwere der Aufgaben nehmen die Leistungen von Ecstasykonsumierenden im Vergleich zu denen abstinenter Personen ab.
Alltagsrelevant dürften auch Einschränkungen im so genannten prospektiven Gedächtnis sein. Das prospektive Gedächtnis wird gefordert, wenn wir uns Dinge merken wollen, die wir in der Zukunft erledigen müssen. Das ist beispielsweise der Fall, wenn man sich an Verabredungen erinnern will oder Medikamente zu einer bestimmten Zeit einnehmen muss.
Allerdings muss auch erwähnt werden, dass die Studienergebnisse nicht immer ganz eindeutig sind. Während einige Untersuchungen deutliche Defizite zeigen, berichten andere nur minimale Unterschiede zwischen Ecstasykonsumierenden und einer abstinenten Vergleichsgruppe. Dies könnte auch daran liegen, dass viele Faktoren eine Rolle spielen, darunter die Konsumhäufigkeit und Dosis sowie die Kombination mit anderen Drogen und genetische Unterschiede.
Die Ergebnisse der Baseler Meta-Studie mit bildgebenden Verfahren lassen vermuten, dass Nervenschäden sich auch wieder zurückbilden können. Mit zunehmender Dauer der Abstinenz von Ecstasy wurde ein ansteigender Serotoninspiegel beobachtet. Das bedeutet: Nach dem Ausstieg aus dem Konsum könnte sich das Gehirn wieder erholen.
Jedoch ist nicht bekannt, ob die Personen wieder das Niveau von Nichtkonsumierenden erreichen oder irgendwo unterhalb des Normallevels verharren. Für Letzteres würden die Ergebnisse aus Tierstudien sprechen. Eine Langzeitstudie mit Konsumierenden hat zudem auch nach 2,5 Jahren Abstinenz keine bedeutsame Verbesserung des verbalen Gedächtnisses finden können. Jedoch konnte in dieser Studie nicht ganz ausgeschlossen werden, dass Konsumierende und Nicht-Konsumierende der Studie unabhängig vom Ecstasykonsum Unterschiede aufweisen.
Durch den Eingriff in den Serotonin-Haushalt kann MDMA kurzfristig die Stimmung heben und Glücksgefühle vermitteln. Doch die Wissenschaft hat zeigen können, dass langfristiger Ecstasykonsum riskant ist. Veränderungen im Gehirn, insbesondere im serotonergen System, sind gut dokumentiert. Vor allem hohe Einzeldosen könnten dabei eine Rolle spielen. Diese strukturellen Veränderungen gehen oft einher mit Einschränkungen der Merkfähigkeit.
Es gibt zwar Hinweise, dass sich die Schäden wieder zurückbilden können, es gibt aber auch Studien, in denen Defizite auch nach längerer Abstinenz noch bestehen.
Quellen:
Kommentare
Um Kommentare schreiben zu können, musst du dich anmelden oder registrieren.