Home > News > Aktuelle Meldungen > Depressionen und bipolare Störung werden schlimmer durchs Kiffen
26.06.2024
Kiffen kann die Stimmung heben. Aber langfristig steigt das Risiko für Depressionen und für die bipolare Störung. Darauf verweist eine aktuelle Studie aus Kanada.

Bild: Christine ten Winkel / photocase.de
„Ich habe schlimme Depression bekommen“, schreibt Le3105 in einem Erfahrungsbericht. Die 30-Jährige hatte am Programm Quit the Shit teilgenommen, weil ihr bewusst geworden sei, dass sie dringend etwas ändern müsse. Wie ihr geht es vielen anderen Teilnehmenden, die über lange Jahre gekifft haben. Die Lebensfreude nimmt ab, der Kontakt zu anderen Menschen wird immer weniger.
Im Einzelfall ist schwer zu bestimmen, welchen Anteil Cannabiskonsum an der Entwicklung einer Depression hat. Die Wissenschaft hat inzwischen aber eine Reihe von Studien zu diesem Thema durchgeführt. Ein Forschungsteam aus Kanada hat aktuell eine systematische Übersichtsarbeit dazu erstellt.
Insgesamt 78 Einzelstudien haben Studienleiter Tony George und sein Team zusammengetragen. Das Fazit der Forschenden lautet: Cannabiskonsum steht nicht nur bedeutsam mit Depressionen in Zusammenhang, auch das Risiko einer bipolaren Störung ist erhöht. Bipolar bedeutet, dass Betroffene zwischen Phasen der Hochstimmung, auch Manie genannt, und Depression schwanken. Depressionen und die bipolare Störung werden als Gemütserkrankungen bezeichnet.
Zwar gibt es keinen sicheren Beleg dafür, dass Cannabis Depressionen alleinverantwortlich auslösen kann, jedoch spricht eine Dosis-Wirkungsbeziehung dafür, dass Cannabis bedeutsam dazu beiträgt: Den Konsumierenden geht es langfristig umso schlechter, je mehr sie kiffen.
Tückisch ist, dass die unmittelbare Wirkung von Cannabis eine gewisse Linderung verspricht. George und sein Team haben Hinweise gefunden, dass depressive oder manische Symptome dem Kiffen oft vorausgehen. Betroffene haben womöglich zu Cannabis gegriffen, weil sie sich eine Verbesserung ihrer Symptome erhofft haben.
Die Analyse der Forschenden hat aber auch verdeutlicht, dass Cannabis für Menschen mit Gemütsstörungen besonders schädlich ist. Nicht nur sind ihre Depressionen ausgeprägter. Sie erleben auch häufigere Wechsel zwischen manischen und depressiven Phasen und haben intensivere Gedanken an eine Selbsttötung als Erkrankte, die nicht kiffen. Gleichzeitig stellt die Übersichtsstudie auch klar, dass es nur minimale Hinweise für eine therapeutische Wirkung gibt. Zur Behandlung von Gemütsstörungen empfiehlt das Forschungsteam, auf Medikamente mit besser gesicherter Wirkung zurückzugreifen.
Damit bestätigt die aktuelle Studie auch Untersuchungen aus Dänemark und den USA, die zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Die dänischen Autorinnen und Autoren der Studie empfehlen Konsumierenden, sich Unterstützung für den Ausstieg aus dem Kiffen zu holen.
So hat es der Quit-the-Shit-Userin Le3105 geholfen, sich an das Beratungsteam zu wenden. „Die Beratung hat mich aus meinem Loch geholt und die Kraft gegeben, das Thema endlich anzugehen. Ich habe mich so verstanden gefühlt“, erklärt die 30-Jährige. Durch die Gespräche habe sie auch den Mut gefasst, sich in eine Klinik zu begeben, was für sie „die beste Entscheidung“ gewesen sei. Ihr Rat lautet daher: „Holt euch professionelle Hilfe!“
Erste Anlaufstellen bei Suchtproblemen sind Suchtberatungsstellen vor Ort oder die Online-Suchtberatung. Zum Thema Cannabis gibt es auch das Online-Programm Quit the Shit. Die Suchtberatung ist kostenlos und anonym nutzbar. Weitere Hilfemöglichkeiten bei akuten Problemen:
Quelle:
Sorkhou, M., Dent, E. L. & George, T. P. (2024) Cannabis use and mood disorders: a systematic review. Frontiers in Public Health, 12, 134620, https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1346207
 Warum junge Menschen mit sozialen Ängsten verstärkt zu Cannabis greifen (12.02.2025)
Warum junge Menschen mit sozialen Ängsten verstärkt zu Cannabis greifen (12.02.2025) Macht Cannabis gleichgültig? (08.01.2025)
Macht Cannabis gleichgültig? (08.01.2025) Höheres Risiko für psychiatrische Probleme bei Konsum von hochpotentem Cannabis (01.01.2025)
Höheres Risiko für psychiatrische Probleme bei Konsum von hochpotentem Cannabis (01.01.2025)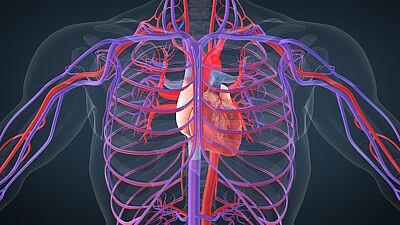 Cannabis und Tabak haben ähnliche Folgen für die Blutgefäße (16.07.2025)
Cannabis und Tabak haben ähnliche Folgen für die Blutgefäße (16.07.2025) Mehr Notfallbehandlungen wegen 420 (18.06.2025)
Mehr Notfallbehandlungen wegen 420 (18.06.2025)
Kommentare
Um Kommentare schreiben zu können, musst du dich anmelden oder registrieren.